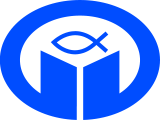100-Jahrfeier der ehemaligen Garnisionkirche St. Martin
Festvortrag von Eberhard Prause am 28.10.2000
Am heutigen Tag und in dieser Stunde ist es einhundert Jahre her, dass dieses Gotteshaus geweiht wurde. In zwei großen Feiern, im evangelischen Teil mit 2000 Sitzplätzen und im katholischen mit 400 Plätzen, wurde erstmals Gottesdienst gehalten. Am Tag darauf, dem 29. Oktober 1900, berichtet ausführlich der „Dresdner Anzeiger“ von diesen beiden Feiern. Dem Berichterstatter ist es so wichtig, dass alle Anwesenden von Rang mit ihren Namen genannt werden, dass kaum mehr Raum bleibt über das zu berichten, was gesprochen wurde. Die Berichte über die gehaltenen Predigten sind kurz und knapp.
Es heißt über die Festpredigt von Pastor Zschucke im evangelischen Teil: „In seiner Einleitung dankt der Kanzelredner vor allem der Dreikönigsgemeinde, die durch 83 Jahre der Garnisongemeinde Gastfreundschaft gewährt, den Behörden und dem Reichstage für Anregung zum Kirchenbaue und die Gewährung der Mittel, den Baumeistern für die herrliche Ausführung des Baues, den Arbeitern für ihren Eifer und ihre Mühewaltung, endlich des Stifters des Kirchenschmuckes für die reichen Geschenke.
Das neue Gotteshaus begrüßte Pastor Zschucke als die Krone der dasselbe umgebenden Bauten und in der Erklärung des Weihetextes führte er aus, dass die innere Bedeutung des Gotteshauses eine dreifache sei, und zwar als Erbauungsstätte, als Opferstätte und als Friedensstätte.“
So weit der Dresdner Anzeiger. Leider wird nichts Näheres aus dem Inhalt der Predigt zitiert.
Das ist beim Bericht über die katholische Feier etwas anders, da hat den Berichterstatter eine Passage der Predigt offenbar sehr beeindruckt. „Die Geistlichkeit begab sich durch den Mittelgang zum Hochaltar und hielt nach dem Gemeindegesange ‘Komm heiliger Geist, kehr bei uns ein… “ der Militärpfarrer Rentsch die Festpredigt, in deren Eingange er die versammelte militärische Gemeinde aufforderte, wie im neuen Gotteshause die Kirchen beider Bekenntnisse eng aneinandergeschmiedet seien und unter dem Schutze ein und desselben Daches stünden, möchten die katholischen Soldaten stets treu stehen in echter Kameradschaft zu den Protestantischen, als Kinder eines Gottes, zu dessen Thron die Gebete der einen wie der anderen aufstiegen…
Als Weihwort hatte der Herr Kanzelredner das Bibelwort gewählt: „Ich will Dein Haus mit Herrlichkeit erfüllen“.
Dieser Gedanke des Predigers vor einhundert Jahren sollte bei allem, was nachher noch zu bedenken ist, nicht untergehen: die Kirchen beider Bekenntnisse sind hier an diesem Ort „aneinandergeschmiedet“ und unter dem Schutz ein und desselben Daches. Beides wird vom Bau her durch die Rekonstruktion dieser Jahre wieder deutlich und schön vor aller Augen ins Bild gesetzt, auch wenn die Nutzung des evangelischen Teiles in Zukunft vielfältiger sein wird, das Symbol unter einem Dach zu sein, bleibt.
Noch wichtiger aber ist der Hinweis, dass die Gebete der einen wie der anderen zum Throne des einen Gottes aufsteigen. Das ist ein schönes Zeugnis dessen, was wir heute ökumenischen Geist nennen. Natürlich ist es in einer Garnisonkirche nicht anders zu erwarten, als dass dieses Zueinanderstehen begründet ist in der militärische Kameradschaft. Und hier nun beginnen ja auch alle die nicht enden wollenden bohrenden Fragen und Probleme, die durch diese Kirche besonders provoziert werden.
Vierzehn Jahre nach der Weihe dieses Gotteshauses begann der Erste Weltkrieg, 39 Jahre später der Zweite Weltkrieg, 45 Jahre danach zogen hier in die Kasernen Soldaten der Sowjetarmee ein, 50 Jahre später die Nationale Volksarmee. 90 Jahre danach die Heeresoffiziersschule der Bundeswehr.
Welch verschiedener Geist, was für unterschiedliche Mächte haben in diesem riesigen Militärgelände gewaltet. Und mittendrin diese Kirche, wie ein Hort des Gebetes und der Vergewisserung, des Segens Gottes für alles Militärische? Wie hatte doch der evangelische Kanzelredner heut vor einhundert Jahren gesagt: Erbauungsstätte, Opferstätte, Friedenstätte. Man hätte gern gewusst, was er darunter verstanden hat. Aber es steht etwas im Grundstein beider Kirchen, der heut vor einhundertfünf Jahren am 28. Oktober 1895 gelegt wurde, das uns einen deutlichen Hinweis gibt.
Die Urkunde des evangelischen Teiles schließt mit den Worten: “ …dass dieser Bau vollendet werde zu seiner Ehre, unserer teuren evangelischen Kirche zur Zierde und Stärke, unserem geliebten Vaterlande zum Heile und denen, die es schirmen zur Förderung in Gottesfurcht und Frömmigkeit. So wachse das Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus in Ewigkeit.“
Und in der Urkunde des katholischen Teiles heißt es: „Der Herr der Heerscharen aber, der dreimalige Heilige lasse seine reiche Gnade walten über dieser Stätte, die wir bereiten, auf dass hier gepflanzt und genährt werde jegliche Mannestugend und wir hier erziehen Schirmer des Vaterlandes und treue Soldaten unseres Herrn Jesu Christi, denen aufbewahrt ist der ewige Loorbeer im Himmel. Dresden, am 28. Oktober 1895. Gez. Von der Planitz, Generalleutnant und Kriegsminister, gez. Von Zeschau, Generalleutnant der Residenz, gez. Rentsch, katholischer Militärpfarrer.“
Es fällt einem heut nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sehr schwer, dieses Denken nachzuvollziehen, aus dem heraus zu verstehen wäre, dass das Reich unseres Herrn und Heilandes wächst, und es der evangelischen Kirche zur Zierde gereicht, wenn das Heil des geliebten Vaterlandes gefördert wird in Gottesfurcht und Frömmigkeit der Soldaten. Jegliche Mannestugend soll gepflanzt und genährt werden, damit Schirmer des Vaterlandes und treue Soldaten erzogen werden.
Es wird eine Verbindung hergestellt, die weder damals noch heute nachvollziehbar ist. „Treue Soldaten unseres Herrn Jesus Christi, denen aufbewahrt ist der eigene Loorbeer im Himmel.“ Dass darunter ein Kriegsminister seine Unterschrift setzt scheint verständlich, aber ein Militärpfarrer?
Diese theologischen Irrwege, die sich hier in diesen Grundsteinen manifestiert haben und mit deren Auswirkungen wir bis heute leben müssen, haben sich besonders im Ersten Weltkrieg in tragischer Weise selbst ad absurdum geführt.
Erich Kästner, hier um die Ecke geboren in der Königsbrücker Straße 66, am 23. Februar 1899, spürt diese Liaison von Thron und Altar, von Staat und Kirche auf in seinem Gedicht „Stimmen aus dem Massengrab“ (Für den Totensonntag. Anstatt einer Predigt).
Da liegen wir und gingen längst in Stücken.
Ihr kommt vorbei und denkt: sie schlafen fest.
Wir aber liegen schlaflos auf den Rücken,
weil uns die Angst um Euch nicht schlafen lässt.
Wir haben Dreck im Mund. Wir müssen schweigen.
Und möchten schreien, bis das Grab zerbricht!
Und möchten schreiend aus den Gräbern steigen!
Wir haben Dreck im Mund. Ihr hört uns nicht.
Ihr hört nur auf das Plaudern der Pastoren,
wenn sie mit ihrem Chef vertraulich tun.
Ihr lieber Gott hat einen Krieg verloren
Und lässt Euch sagen: Lasst die Toten ruhn!
Ihr dürft die Angestellten Gottes loben.
Sie sprachen schön am Massengrab von Pflicht.
Wir lagen unten, und sie standen oben.
„Das Leben ist der Güter höchstes nicht.“
Da liegen wir, den toten Mund voll Dreck.
Und es kam anders, als wir sterbend dachten.
Wir starben. Doch wir starben ohne Zweck.
Ihr lasst Euch morgen, wie wir gestern, schlachten.
Vier Jahre Mord, und dann ein schön Geläute!
Ihr geht vorbei und denkt: sie schlafen fest.
Vier Jahre Mord, und ein paar Kränze heute!
Verlasst Euch nie auf Gott und seine Leute!
Verdammt, wenn Ihr das je vergesst!
———————————————
Und man fragt sich heut, wie vielen Menschen mag das den Glauben gekostet haben „an Gott und seine Leute“?
Liegt hier nicht eine der tiefen Wurzeln für den später aufbrechenden Atheismus einer Generation, die sich verraten fühlte und deren Kinder im nächsten Krieg die Erbschaft ihrer Väter noch einmal vergällt bekamen? Hatte es da nicht eine marxistisch-leninistische Ideologie leicht, die Vertreter der Kirchen auf die Seite der Herrschenden und der Militärs zu stellen und als Kriegstreiber abzustempeln im Interesse der herrschenden Klasse?
Das sind Fragen, um die wir nicht herum kommen, wenn wir uns den Geist besehen, der diese Kirche entstehen ließ. Diese scheinbar theoretischen Kopfprobleme haben sich ja in den Jahren der Weltkriege in Millionen von Einzelschicksalen widergespiegelt.
Erich Kästners Königsbrücker Straße war nicht nur sein Ort der Kindheitserlebnisse, sondern hier hat er auch als Soldat Wache gestanden vor der Pionierkaserne, vor dem Portal, da heut der Eingang zum Landesfunkhaus ist. Und er hat seine Ausbildung ebenfalls in diesem Gelände hier durchgemacht. Wie in einem Brennglas wird in seinen Gedichten und Prosatexten die Wirklichkeit des Soldatenlebens im Gegensatz zu den Feiertagsreden offen gelegt:
Sergeant Waurich
Das ist nun Dutzend Jahre her,
da war er unser Sergeant.
Wir lernten bei ihm: „Präsentiert das Gewehr!“
Wenn einer umfiel, lachte er
und spuckte vor ihm in den Sand.
„Die Knie beugt!“ war sein liebster Satz.
Den schrie er gleich zweihundertmal.
Da standen wir dann auf dem öden Platz
und beugten die Knie wie die Goliaths
und lernten den Hass pauschal.
Und wer schon auf allen vieren kroch,
dem riss er die Jacke auf
und brüllte: „Du Luder frierst ja noch!“
Und weiter ging’s. Man machte doch
in Jugend Ausverkauf …
Er hat mich zum Spaß durch den Sand gehetzt
und hinterher lauernd gefragt:
„Wenn du nun meine Revolver hättst –
brächtst du mich um, gleich hier und gleich jetzt?“
Da hab ich „Ja!“ gesagt.
Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie.
Den legt man sich auf Eis!
Er war ein Tier. Und er spie und schrie.
Und Sergeant Waurich hieß das Vieh,
damit es jeder weiß.
Der Mann hat mir das Herz versaut.
Das wird ihm nie verziehn.
Es sticht und schmerzt und hämmert laut.
Und wenn mit nachts vorm Schlafen graut,
dann denke ich an ihn.
Im Vorraum des Turmes dieser Kirche wurden sechs Tafeln mit den Namen der in Frankreich Gefallenen von 1870/71 angebracht. Die Orte tragen die gleichen Namen wie die der Ereignisse von 1914 – 18. Nur, dass es im Krieg 45 Jahre später weitaus grausamer und martialischer zuging.
Erich Maria Remarque schildert in seinem weltberühmten Roman ‘Im Westen nichts Neues’ wie ein deutscher und ein französischer Soldat nacheinander in den gleichen Bombentrichter springen. Der Deutsche ersticht den Franzosen, der dann langsam neben ihm stirbt.
„Das Schweigen dehnt sich. Ich spreche und muss sprechen. So rede ich ihn an und sage es ihm. „Kamerad, ich wollte dich nicht töten. Sprängst du noch einmal hier hinein, ich täte es nicht, wenn auch du vernünftig wärest. Aber du warst mir vorher nur ein Gedankte, eine Kombination, die in meinem Gehirn lebte und einen Entschluss hervorrief – diese Kombination habe ich erstochen. Jetzt sehe ich erst, dass du ein Mensch bist wie ich. Ich habe gedacht an deine Handgranaten, an dein Bajonett und deine Waffen – jetzt sehe ich deine Frau und dein Gesicht und das Gemeinsame. Vergib mir, Kamerad! Wir sehen es immer zu spät.
Warum sagt man uns nicht immer wieder, dass ihr ebenso arme Hunde seid wie wir, dass eure Mütter sich ebenso ängstigen wie unsere und dass wir die gleiche Furcht vor dem Tode haben und das gleiche Sterben und den gleichen Schmerz -. Vergib mir, Kamerad, wie konntest du mein Feind sein. Wenn wir diese Waffen und diese Uniform fortwerfen, könntest du ebenso mein Bruder sein wie Kat und Albert. Nimm zwanzig Jahre von mir, Kamerad, und stehe auf – nimm mehr, denn ich weiß nicht, was ich damit beginnen soll.“
Wenn man sich Zeit nimmt und hinübergeht zum Friedhof dieses Kasernengeländes findet man ein groß angelegtes Monument für die Generationen der „Gefallenen“, wie man den grausamen Tod dieser jungen Männer ummäntelte. Und es findet sich dort in der gleichen verschleiernden Sprache wie im großen Schlussakt wieder, was hier in den Grundsteinen seinen Anfang nahm.
Mag der Staub gefallner Helden modern,
die dem großen Tode sich geweiht,
ihres Ruhmes Flammenzüge lodern
in dem Tempel der Unsterblichkeit.
Ratlos und sprachlos steht man heut vor diesem gut gepflegten Monument. Alle Armeen dieser einhundertfünfzig Jahre gedenken der auf diesem Friedhof „Gefallenen Helden“. Freund und Feind sind im Tod vereint. Soldaten vieler Länder Europas. Die gefallenen Helden modern. Doch wo ist der Tempel der Unsterblichkeit?
Ist es eventuell bei aller Zwiespältigkeit eher diese Kirche, die über das Gedachte, Beabsichtigte und Gewollte von vor einhundert Jahren hinaus hier steht und nun, endlich auch baulich erneuert, ein Zeugnis für den schlichten Glauben an Gott ist, unter dem Verzicht auf irgend etwas ‘Heldenhaftes’ oder gar unter uns Menschen ‘Unsterbliches’?
Wie kaum irgendwo brechen sich in diesem Bau die Linien vom zweiten zum dritten Jahrtausend. Das Neue wird ja mit viel Aufwand begrüßt, ist aber der Abschied auch durchlebt und somit gründlich durchdacht?
Wir finden es zusammengebracht in dem Klage- und Hoffnungsschrei von Wolfgang Borchert, der die Not des Krieges in die ganze Generationen geschleudert wurden, in die Worte fasst:
„Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam und unsere Jugend ist ohne Jugend. Wir sind die Generation ohne Grenze, ohne Hemmung und Behütung – ausgestoßen aus dem Laufgitter des Kindseins in eine Welt, die die uns bereitet, die uns darum verachten.
Aber sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten können, wenn die Winde dieser Welt es umwirbelten. So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung …
Aber wir sind eine Generation der Ankunft. Vielleicht sind wir eine Generation voller Ankunft auf einem neuen Stern, in einem neuen Leben. Voller Ankunft unter einer neuen Sonne, zu neuen Herzen.
Vielleicht sind wir voller Ankunft zu einem neuen Lieben, zu einem neuen Lachen, zu einem neuen Gott.
Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört.“
Das Stichwort heißt also Ankunft, und damit Gegenwart und auch Zukunft.
Bis hierher ist da ja vielleicht nicht das, was Sie als Festrede erwartet haben. Zu solchen Anlässen liebt man sonst mehr die schöne Rede, die erhebenden Gedanken. Aber dieser Ort gebietet diese Redlichkeit einer tragischen Geschichte gegenüber der zu bedenkenden 100 Jahre.
Wie hat es doch Erich Kästner 1945 in seinem Tagebuch notiert: „Die Vergangenheit muss reden, und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden.“
Die Versuchung ist zu allen Zeiten groß, zu schnell seine Ruhe vor der Vergangenheit haben zu wollen, man darf sich dann nicht wundern, dass eine pädagogische Wirkung auf junge Leute ausbleibt und sie erneut Rattenfängern hinterher laufen und meinen, gewalttätig sein zu dürfen.
Es scheint, wir reden noch von der Vergangenheit, wenn diese Kirche als ein Zeichen des Verfalls von 1945 bis 1990 gesehen werden muss. Fast ohne Beschädigung aus dem großen Aschermittwoch der Stadt Dresden des 14. Februar 1945 hervorgegangen, diente sie kurze Zeit als Konzertsaal in ihrem größeren Teil. Und es begann durch die Zerstörung der katholischen Kirche am Albertplatz am 17. April 1945 eine neue Geschichte dieser Kirche mit einer Ortsgemeinde, wofür sie nicht gedacht und gebaut war, worin aber nun ihre Zukunft besteht. Dass Gleiches für den evangelischen Teil nicht möglich war und ist, liegt schlicht daran, dass fast zur gleichen Zeit mit dieser Garnisonkirche in diesem Stadtteil drei evangelische Kirchen erbaut wurden, 1888 die Martin-Lutherkirche, 1891 die Paulikirche und 1895 die Petrikirche.
Sie alle gingen hervor aus der viel älteren Gemeinde, der Dreikönigskirche.
Es ist also niemandem ein Vorwurf zu machen, wenn nach einer kurzen Nutzung durch die St. Pauli Gemeinde der für sie viel zu große Raum 1965 aufgegeben wurde. Damit war die Kirche aber auch dem Verfall preisgegeben. Sie wurde inmitten der Kasernen der Sowjetsoldaten und der Nationalen Volksarmee ein Zeichen für das Absterben von Religion und Kirche im Sinne des Atheismus, der Ideologie des Marxismus-Leninismus.
In einem Brief vom 1.2.1968 schreibt der damalige Pfarrer Johannes Klante an den Oberbürgermeister von Dresden:
„Wir möchten sehr Ihre Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Zustand der Martinskirche (ehemals Garnisonskirche) lenken. Die Fenster sind zum großen Teil eingeschlagen, das Dach ist undicht, das Gelände um die Kirche ist vernachlässigt. Die Kirche ist nach außen hin ein unvorstellbarer Schandfleck.
Seitdem die evangelische Kirche das Benutzungsrecht für ihren Teil aufgegeben hat, wissen wir nicht, wer für die Instandhaltung verantwortlich ist.
Die Kirche verfällt mehr und mehr, und der zur Zeit als Pfarrkirche dienende katholische Teil für Dresden-Neustadt ist damit ebenfalls vom Verfall bedroht.
In- und ausländische Besucher unserer Stadt drücken über den Zustand der Kirche ihr Befremden, Entsetzen und ihre Enttäuschung aus.
Immer wieder geschehen nachts Einstiege von unbekannten Personen. Die Gottesdienstbesucher der katholischen Gemeinde müssen vom Platz der Thälmann-Pioniere aus einen Weg benutzen, der nicht den normalen Anforderungen entspricht und kaum zumutbar ist.
Wir bitten im Interesse des Ansehens unserer Stadt, der DDR und unserer Gemeinde unbedingt um eine Besichtigung des Geländes.“
Mit diesem Protest, auch in der sowjetischen Kommandantur, und den Berichten darüber beginnt auch meine sogenannte Stasiakte, da ich von 1965 – 68 Kaplan in dieser Gemeinde war.
Der Verfall der Kirche war aber nicht aufzuhalten. Und es ist schon ein symbolisches Zeichen: Wenn ein Teil zerfällt, verfällt der andere mit. Was unter einem Dach geplant war, bleibt bis heut „aneinander geschmiedet“ wie es vor einhundert Jahren gesagt wurde. Und das ist auch in Zukunft zu beachten. Denn zwischen diesen beiden Teilen steht der Turm und auf ihm leuchtet seit Oktober 1999 wieder ein vergoldetes Kreuz, der Turm lebt wieder durch die Uhr und die Glocken, die 25 Jahre schwiegen und seit 1970 wieder zum Gottesdienst rufen.
Der katholischen Neustädter Gemeinde und ihren Seelsorgern kann man nicht dankbar genug sein, dass sie nie den Kampf gegen die Mächte des Zerfalls aufgegeben haben.
Die sowjetischen und deutschen Soldaten sind an ihr wie an einem Fremdkörper vorbeimarschiert. Die wenigen, die kamen, mussten es heimlich tun und hatten zuvor ihre Uniform im Pfarrhaus ausgezogen. Es gab wunderschöne Begegnungen.
Wir, die wir heute die Wiederauferstehung dieser Kirche sehen und feiern, sollten uns daran erinnern, wie ätzend und deprimierend diese Jahrzehnte des schleichenden Zerfalls waren. Diese gähnende Leere und Ohnmacht, ohne Aussicht auf Veränderung. In diesem Bau hat sich widergespiegelt, was Nationalsozialismus und Sozialismus am Menschen angerichtet haben: Zerfall aller Werte, Überheblichkeit der ideologischen Überzeugung, Unfähigkeit dem Menschen gerecht zu werden, das Auslöschen aller transzendenten Dimensionen unseres Daseins. Und die Bereitschaft, für diese Ideologie Menschen in den Tod zu schicken.
Am 20. August 1998 wurde ein für diese Kirche so wichtiger Vertrag geschlossen zwischen der Bundesrepublik Deutschland als Verkäufer und Herrn Manfred Kaiser aus Deining als Käufer. Ein Kuriosum auf beiden Seiten. Der Bund war durch die Wiedervereinigung nach der Rechtslage der Eigentümer dieser Kirche geworden und Herr Kaiser hatte den Mut, diese Kirche zu kaufen. Er bekam diese Kirche für Null DM, aber mit der Auflage der Kaufgegenleistung des Bauunterhaltes am gesamten Baukörper der Martinskirche, wie sie im Vertrag nun heißt, einschließlich des Turms.
Wenn wir nun hier in einem Raum sind, dessen kompliziertes und schönes Dach einschließlich des Turmes saniert und zum Teil ganz neu geschaffen wurden, so hätte nach Vertragslage Herr Kaiser dazu 12 Jahre Zeit gehabt. Er hat es in 2 Jahren in bester Bauausführung geschafft. Dafür kann man nicht genug dankbar sein.
Nun geht es an die Gestaltung der Innenräume, deren Hauptnutzer in diesem katholischen Teil die Pfarrei Franziskus-Xaverius ist, gemeinsam mit der katholischen und der evangelischen Militärseelsorge, denen der gesamte Bau nach wie vor gewidmet bleibt.
Da die evangelische Kirche ihr Widmungsrecht zur kirchlichen Nutzung des evangelischen Kirchenraumes nicht ausübt, kann dieser Teil zu einer Mehrzwecknutzung um bzw. ausgebaut werden. Dafür sind die Pläne schon weitestgehend vorhanden. Man kann gespannt sein, wie sich diese Nutzung gestaltet, deren Voraussetzungen nach Vertragstext einmal die „würdevolle Nutzung der Martinskirche“ ist und zum anderen, dass dieses Bauwerk seit 1995 zu den Kulturdenkmälern der Landeshauptstadt Dresden gehört.
Bevor es zu dieser neuen und überraschenden Rechtslage kam, hatte sich in den Jahren davor ein Verein gebildet, der „Förderverein Simultankirche St. Martin e.V.“. Ihm ist es unter Leitung von Herrn Thomas Socha ganz wesentlich zu verdanken, dass Pläne aufgegeben wurden, diese Kirche zu verlassen und sich auf der Lößnitzstraße anzusiedeln. Zeichenhaft für dieses Ja zur Martinskirche begann der Verein mit gesammelten Spenden die Buntglasfenster zu erneuern.
Das war und ist Zeichen nach innen und außen, dass diese Kirche nicht nur Förderer hat, sondern hier eine Gemeinde lebt und Gottesdienst feiert, inzwischen auch an den Werktagen durch den Wegfall der Kapelle des Bennostiftes. Bald wird durch den Bau des Pfarrzentrums wenige Meter neben der Kirche, eines Kindergartens mit 80 Plätzen und einer Anlage für betreutes Wohnen mit 70 Plätzen, diese Kirche immer mehr zu einem lebendigen Haus.
In seiner Urkunde für den Grundstein des Turmes hatte König Albert den Bau der Kirche damit begründet, dass er am 1. Oktober 1893 eine „Heeresvermehrung“ angeordnet und durchgeführt habe. Diese führte dazu, dass ein eigens Gotteshaus für die Garnison Dresden mehr und mehr zur Notwendigkeit wurde, da hier inzwischen Zehntausend Soldaten lebten. Aus diesen Gründen sind heut ganz andere geworden, aber eine wohlverstandene „Heeresvermehrung“ möchte man auch der Neustädter Gemeinde wünschen und sie gibt es bereits.
Hier ist aber auch in Zukunft die Militärseelsorge zu Hause. Ihnen, den Angehörigen des Bundeswehr, gilt nach wie vor die Widmung dieser Kirche. Im Unterschied zu allen ihren Vorgängern, ist das Selbstverständnis und die Tradition der Bundeswehr „wesentlich von den freiheitlichen Werten der deutschen Militärgeschichte geprägt, wie sie sich mit dem Namen Gerhard von Scharnhorst verbindet. Daneben gehört der Geist des deutschen Widerstandes gegen die nationalsozialistische Diktatur zu dem ethischen Fundament, auf dem die Bundeswehr aufbaut.“
Die Erinnerung an Generalmajor Hans Oster hier auf dem nahegelegenen Friedhof, der zum innersten Kreis des Widerstandes gegen Hitler gehörte und am 9. April 1945 auf Befehl Hitlers in Flossenbürg hingerichtet wurde, ist deshalb ein wichtiger Ort gegen das Vergessen. Hans Oster wurde zusammen mit dem großen Theologen Dietrich Bonhoefer am gleichen Tag hingerichtet.
Hans Oster war der Sohn eines reformierten Pfarrers aus Dresden, sein Abitur legte er an der Kreuzschule ab. Als er hier in Dresden in der Armee Dienst tut, ist er zusammen mit den späteren Hitlergegnern General Friedrich Olbricht, General Karl Heinrich von Stülpnagel, Generaloberst Ludwig Beck und mit Generalfeldmarschall von Rommel. Deshalb wird die Garnison in Dresden auch als die Keimzelle des späteren militärischen Widerstandes bezeichnet.
Zehn Jahre „Armee der Einheit“, so heißt eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum hier an der Stauffenbergallee. Dort wird an all das erinnert, was wir zu schnell schon als Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass Angehörige zweier sich feindlich gegenüberstehender Bündnissysteme der Nato und des Warschauer Paktes, friedlich und ohne Widerstand zu einer Armee wurden, und dass mit einem militärischen Zeremoniell am 3. Februar 1995 die letzen sowjetischen Truppen aus Deutschland verabschiedet wurden. Wer hätte das gedacht, die Nationale Volksarmee geht von 2. zum 3. Oktober 1990 in der Bundeswehr auf und die sowjetischen Truppen verlassen das Land.
Angesichts des erschütternden Leides zweier vorausgegangener Weltkriege darf dieses ganz besondere Geschenk der deutschen Einheit nie unter das Selbstverständliche geraten. Das hatte es in dieser Größenordnung bisher noch nicht gegeben in Europa. Eine Vision von Frieden wurde wahr. Nun ist diese Kirche eine Friedensstätte, wie der Prediger vor einhundert Jahren sagte. Dass es doch so bleiben möge.
König Albert schließt seine Urkunde für den Turm mit den Worten, die recht verstanden so auch heute noch gelten können:
„Wir erflehen den Segen Gottes für diesen Bau, welcher sich an dieser Stelle erheben soll. Möge er vollendet werden zu seiner Ehre und zu seinem Preise, zum Segen und zum Heile der Gemeinden als ein Stätte des Friedens und zur Zierde unserer Hauptstadt.“
Msgr. Eberhard Prause